AVIVA-Berlin >
Jüdisches Leben
AVIVA-BERLIN.de 7/12/5786 -
Beitrag vom 09.02.2007
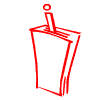
Unechte Juden, echte Probleme
Sergey Lagodinsky
Jû¥dische IdentitûÊt in Deutschland. Ein Essay von Sergey Lagodinsky, verûÑffentlicht im Schweizer Magazin Tachles, jetzt auch auf AVIVA zu lesen
Unechte Juden, echte Probleme
Nach Jahren quûÊlender Suche hat sich der Schleier der Unwissenheit gelû¥ftet. Endlich weiss ich, wer ich bin ã ein unechter Jude!
In meiner NaivitûÊt suchte ich nach mir in mir selbst. Dabei hûÊtte ja eigentlich ein Blick in meine Tageszeitung genû¥gt. AnlûÊsslich des Jahrestags der Reichspogromnacht erklûÊrt nûÊmlich die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" im November 2006 ihren Lesern im Leitartikel, was zu den grûÑssten Herausforderungen der jû¥dischen Gemeinden in Deutschland gehûÑre: die Aufgabe, aus russischen Juden "echte Juden" zu machen. Diese eine Zeile genû¥gte, um mir meine jû¥dische AuthentizitûÊt zu nehmen ã Seite eins, rechts unten, dort, wo man sonst û¥ber Iran, die Bundeskanzlerin oder die MehrwertsteuererhûÑhung schreibt.
Seitdem lebe ich in Deutschland als unechter Jude, immerhin eine Verbesserung im Vergleich zum bû¥rokratischen "Kontingentflû¥chtling" oder dem abfûÊlligen "Russen". Dem wûÊre nichts weiter hinzuzufû¥gen, wûÊre da nicht dieses komische Gefû¥hl im Bauch. Zum einen klingt "unecht" irgendwie missbrûÊuchlich: Was will ein unechter Jude in unserem echten Deutschland? Natû¥rlich eine ungerechtfertigte Bereicherung! Das klingt nach Sozialhilfeerschleichung und Betrug. Kurzum: "unecht" klingt nach ôÏ263 StGB, und das ist nicht sexy. Zum anderen klingt "unecht" wie "ungleich". Was haben denn unechte Juden in unseren echten jû¥dischen Gemeinden eigentlich zu melden? So wenig wie mûÑglich, bitte schûÑn!
Mit diesem mulmigen Gefû¥hl im Bauch fragte ich mich, was denn der FAZ-Redakteur genau im Kopf hatte, als er diese eine Zeile schrieb. Natû¥rlich hatte er das im Kopf, was alle im Kopf haben, wenn sie in Deutschland û¥ber Juden reden ã nûÊmlich ein bestimmtes Judenbild. Danach mû¥ssen deutsche Juden nicht nur wie Albert Einstein denken, wie Heinrich Heine dichten, oder zumindest wie Ignaz Bubis mit Immobilien handeln, sie mû¥ssen vor allem glauben. Das mit Einstein und Bubis bereitet mir weniger Sorgen als das mit dem Glauben.
AntireligiûÑse Erziehung
In der Sowjetunion, wo ich, wie 90 Prozent aller "deutschen" Gemeindemitglieder, aufgewachsen bin, wurde man nicht nur areligiûÑs, sondern antireligiûÑs erzogen. Religion wurde ûÊhnlich einer drogenbedingten Halluzination mit dem skeptischen Blick eines Suchttherapeuten betrachtet. Und wenn man sie nicht als das Opium fû¥r das Volk behandelte, so zumindest wie einen Joint oder (etwas poetischer) wie ein MûÊrchen.
War Religion durch die Erziehung und das kulturelle Umfeld einmal diskreditiert, so musste man nach anderen Referenzpunkten fû¥r das eigene Jû¥dischsein suchen. Entgegen gelûÊufiger Meinung tat man dies durchaus freiwillig, hûÊufig gerne, und bezog sich dabei auf zahlreiche Referenzen. Wie Anna Shternshis von der UniversitûÊt Toronto zeigt, war zum Beispiel in den dreissiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Kultur der jiddischen Sprache ein derartiger IdentitûÊtspunkt. Danach kam eine Mischung aus Familiengeschichten, jû¥dischem Humor, dem Stolz und Interesse an Kunst und Literatur von und û¥ber Juden, sowie das grenzû¥berschreitende Spiel "Welche Prominenten sind eigentlich Juden?", was in der Sowjetunion, wo die Prominenz ihre jû¥dische IdentitûÊt nur selten ûÑffentlich thematisierte, einen besonderen Reiz darstellte.
Nun mag diese IdentitûÊt skurril oder abenteuerlich erscheinen, sie war und bleibt aber eine echte und eine jû¥dische. Vor allem war sie weder lediglich "negativ" (durch Ausgrenzung bestimmt) noch "traurig" (durch Fremdkonstruktion verunstaltet). Ganz im Gegenteil: Man lebte diese IdentitûÊt hûÊufig mit Stolz, Wû¥rde und Freude aus. Nur drehte sie sich nicht um das religiûÑse, sondern um das ethnische SelbstverstûÊndnis, wonach das jû¥dische Volk in erster Linie ein Volk ist und auch ohne die Religion seine IdentitûÊt behalten konnte.
KontinuitûÊtsfunktion
Mit dieser ethnisch-jû¥dischen Identifikation kamen die ehemals sowjetischen Juden nach Deutschland. Das erste, was sie hier erfuhren, war eine krude Dekonstruktion ihres jû¥dischen Selbst. Beteiligt daran sind sowohl die nichtjû¥dische Mehrheitsgesellschaft als auch die nichtrussisch-stûÊmmigen Gemeindemitglieder. Fû¥r sie alle steht nûÊmlich fest, dass nur ein religiûÑser Jude ein guter Jude sei. Alle anderen sind es nicht. Alle anderen sind deshalb unecht. Die Leidtragende in diesem Wettlauf zwischen Religion und Ethnie ist die jû¥dische Zukunft in Deutschland. Denn traditionell erfû¥llte die Religion eine doppelte Funktion: einerseits schweisste sie die Juden um ihre Gemeinde herum zusammen, andererseits sicherte sie das Fortbestehen dieser Gemeinden û¥ber Generationen hinweg. Mit der Einwanderung a(nti)religiûÑser sowjetischer Juden geraten aber die Konsolidierungsfunktion der religiûÑsen IdentitûÊt und ihre KontinuitûÊtsfunktion in ein unerwartetes SpannungsverhûÊltnis. Immer noch ist Religion fû¥r die zukû¥nftige Sicherung jû¥discher Existenz in Deutschland unentbehrlich. Doch statt auch in der Gegenwart zentrifugal zu wirken, also die jû¥dischen Menschen hin zu den Gemeinden zu bringen, ist die Wirkung der Religion in der Gegenwart genau umgekehrt. Die Betonung des ausschliesslich ReligiûÑsen, verbunden mit der Abwertung des ethnisch-jû¥dischen, stûÑsst die Einwanderer weg von den Gemeinden. Dies mag bedauerlich sein, aber eine IdentitûÊt kann man nicht wie Handschuhe wechseln, sie haftet einem an und jeder Versuch, sie gewaltsam zu ûÊndern, endet in einem passiven Widerstand der Seele. In diesem Falle im Fernbleiben von Gemeindestrukturen.
Der Einwanderungscharakter der jû¥dischen Gemeinden in Deutschland hat uns also einen IdentitûÊtsbruch des Judentums in Deutschland beschert. Dieser stellt uns vor ein schwieriges Dilemma, was die Zukunftssicherung der Gemeinde betrifft: Setzt man auf SûÊkularitûÊt, gefûÊhrdet man die Zukunft der Gemeinden, denn ein sûÊkulares Judentum kann nur schwer û¥ber Generationen hinweg û¥berleben. Betont man das ReligiûÑse, gefûÊhrdet man aber den Bestand der Gemeinde, man verliert heute schon einen Grossteil derer, deren Zukunft man erst sichern mûÑchte ã eine grosse lebendige Gemeinschaft von Menschen, die ihre vorhandene IdentitûÊt frûÑhlich und freiwillig ausleben. Damit stehen wir vor einer schwierigen Alternative: Mitgliederstarke sûÊkulare Gemeinden heute oder kleine religiûÑse Gemeinden morgen?
ReligiûÑse Erwachsenenbildung
Was also tun? Wenn keine Alternative befriedigend ist, hilft wie immer ein Mittelweg. Dieser mû¥sste in einer Mischung zwischen der akzeptierten EthnizitûÊt einerseits und einer intellektuellen ReligiositûÊt andererseits bestehen. Das erstere bestû¥nde in einer Akzeptanz der mitgebrachten jû¥dischen IdentitûÊt ehemaliger sowjetischen Juden. Man soll aufhûÑren, diese IdentitûÊt als unecht, als negativ, als minderwertig zu bezeichnen. Es gibt keine minderwertigen IdentitûÊten, erst recht nicht, wenn eine IdentitûÊt die û¥berwiegende Mehrheit der Gemeinde ausmacht.
Es heisst aber nicht, dass man durch das Ethnische das ReligiûÑse ausblenden muss. ReligiûÑse Erwachsenenbildung ist der Schlû¥ssel zur zukunftsgewandten jû¥dischen Existenz. Diese muss aber anspruchsvoll und pûÊdagogisch geschickt stattfinden. Auch wenn Einwanderer mit Akzent sprechen, bringen sie grosse intellektuelle KapazitûÊten mit. Man darf also die Sprache der religiûÑsen Bildung nicht an die Sprache der Einwanderer anpassen, sondern an ihre intellektuelle FûÊhigkeiten und ihren Bildungsgrad. Bisher hat man nûÊmlich versucht, den Zuwanderern, wie Kindern, das Judentum in einer MûÊrchensprache zu vermitteln. Man kann sich mittlerweile vor theatralischen Chanukka-Auffû¥hrungen kaum retten, doch was vermittelt man Menschen û¥ber die philosophischen, literarischen und real-geschichtlichen Hintergrû¥nde ihrer Religion? Diese anspruchsvolle Herangehensweise findet nicht statt. Stattdessen spricht man zu erwachsenen und gebildeten Menschen in einer MûÊrchensprache, die ja das bei ihnen schon ohnehin vorhandene Bild der Religion als MûÊrchen bestûÊtigt. Man muss also verstûÊrkt in die Erwachsenenbildung investieren, die auf intellektuelle ReligiositûÊt zielt, neue moderne Religionsformen thematisiert, die gegenwûÊrtige Relevanz von religiûÑsen Themen hervorhebt. Nicht zu niedrig ansetzen, lieber zu hoch!
Die Grundlage fû¥r akzeptierte EthnizitûÊt wie fû¥r intellektuelle ReligiositûÊt ist dieselbe: Ein respektvoller Umgang mit jû¥dischen Einwanderern sowohl von Seiten der jû¥dischen Alteingesessenen als auch von Seiten der nicht jû¥dischen Mehrheitsgesellschaft ist fû¥r beides bestimmend. Nur wenn man mit Respekt miteinander spricht, einander hilft und voneinander lernt, werden alle erkennen, dass wir in einer Welt leben, in der es echte Probleme, aber schon lange keine unechten IdentitûÊten gibt. Auch dann nicht, wenn die ô¨Frankfurter Allgemeine Zeitungô£ uns das Gegenteil weismachen will.
ôˋ 2001-2007 tachles Jû¥disches Wochenmagazin.
Jegliche Publikation dieses Artikels ohne Quellenangabe ist untersagt.