AVIVA-Berlin >
Women + Work > Lokale Geschichte_n
AVIVA-BERLIN.de im Februar 2026 -
Beitrag vom 16.02.2015

Sabrina Goldemann: Mit Sarkasmus gegen den alltûÊglichen Antisemitismus
Sabrina Goldemann
Sabrina Goldemann ist Journalistin und historische Beraterin, war Mitarbeiterin der GedenkstûÊtte Yad Vashem und ist nach langem Aufenthalt in Israel wieder in Berlin. Mit ihrer Dialogpartnerin,...
... der in Iran geborenen Filmemacherin Fathiyeh Naghibzadeh, hat sie û¥ber aktuellen Antisemitismus in Deutschland, û¥ber ihr VerhûÊltnis zu diesem Land und û¥ber ihre Familiengeschichte gesprochen.
Fathiyeh: Du hast erzûÊhlt, dass du nach Israel ausgewandert bist und lange dort gelebt hast. Warum wolltest du auswandern?
Sabrina: Anfang der 90er Jahre war ich Mitarbeiterin im Berliner Bû¥ro der Wochenzeitung Jû¥dische Allgemeine. In dieser Zeit erlebte ich den ersten Irakkrieg: Israel erhielt zum Dank dafû¥r, dass es sich aus den KûÊmpfen heraushielt, von Saddam Hussein Raketengrû¥ûe auf Tel Aviv. WûÊhrend die Israelis mit Gasmasken in SchutzrûÊumen saûen, demonstrierten FriedensfreundInnen auf deutschen Straûen ausgerechnet gegen den "israelischen Aggressor".
Antisemitische Angriffe ã Plastikratten und Schuldumkehr
Zeitgleich bekam ich meine ersten anonym geschickten Plastikratten ins Bû¥ro inklusive der Aufforderung, endlich dahin zu gehen, wo "wir hergekommen sind". Ich begann mich ernsthaft mit der Auswanderung zu beschûÊftigten. Ein Ex-Kommilitone brachte das Fass zum ûberlaufen, als er mich damals fragte, warum uns (Juden) alle hassen? Das mû¥sse doch einen Grund haben. Wahrscheinlich sucht er den immer noch. Meine Auswanderung sollte sich noch neun Jahre hinziehen, weil mein damaliger Mann als Kind einen schweren Umzug von Israel nach Berlin hatte und seinen Kindern nicht die gleichen Erfahrungen zumuten wollte.
Fathiyeh: Wie bist du mit Antisemitismus in Deutschland umgegangen?
Sabrina: Meine Schmerzgrenze war hinsichtlich antisemitischer Stereotype oder Klischees immer recht hoch. Ich glaube, mit der Zeit wûÊchst eine mentale Hornhaut. Entweder stumpft man ab, kûÊmpft als selbsthassende Jû¥din am Al Quds-Tag fû¥r die Befreiung Jerusalems mit oder geht den unbequemen Weg, sich zu wehren und etwas zu ûÊndern. Ich wûÊhlte die letzte Option und entwickelte dazu einen gewissen Sarkasmus. Viele meiner jû¥dischen AltersgenossInnen haben sich lange in ihrem kleinen Mikrokosmos eingeschlossen, die bûÑse Welt drauûen gelassen und alles MûÑgliche verdrûÊngt. Das wollte ich nicht.
Als engagierte Journalistin blickte ich in den Schlund der gesellschaftsfûÊhig gewordenen antisemitischen Ressentiments. Was ich sah, gefiel mir gar nicht. Ein gutes Jobangebot brachte meiner Familie schlieûlich den von mir lang ersehnten Umzug nach Israel. Das war kurz bevor Ariel Scharon den Tempelberg besuchte und nach Meinung der ganzen Welt ausschlieûlich damit die zweite Intifada auslûÑste. Die folgenden vier Jahre sollten fû¥r Israel sehr blutig werden und mich noch stûÊrker an das Land schweiûen, obwohl ich natû¥rlich nicht blind und unkritisch durch den israelischen Alltag gelaufen bin. Die internationale Berichterstattung lief in Sachen "Nahost" zu einseitiger HûÑchstform auf, und ich habe geschworen, niemals wieder in Europa zu leben.
Fathiyeh: Warum hast du Israel doch verlassen?
Sabrina: Vor vier Jahren wurde meine Mutter sehr krank und ich bin viermal jûÊhrlich nach Berlin geflogen. Das ging alles nicht mehr. Ich war mittlerweile voll berufstûÊtig, alleinerziehend mit zwei Kindern und ohne eigene Wohnung. Keine gute Kombination in Israel. Ich entschied mich schweren Herzens, mit meiner Tochter, die vom Gazakrieg 2012 traumatisierter war als ich dachte, nach Berlin zu ziehen. Seit û¥ber einem Jahr versuche ich jetzt, kreativ, das Beste daraus zu machen. Der Koffer ist aber halb gepackt geblieben, denn mit einem Bein bin ich beim Sohn in Israel.
Aufwachsen mit dem Judenhass der Entnazifizierten
Fathiyeh: War es fû¥r dich schwer, als Jû¥din in Deutschland aufzuwachsen?
Sabrina: Oh ja. Fû¥r mich war schon sehr frû¥h klar, dass Deutschland und ich ein ungleiches Paar Schuhe sind. Die Mitschû¥ler gaben mir oft das Gefû¥hl, anders zu sein, und die Altnazis innerhalb des LehrkûÑrpers verstûÑrten mein kindliches Gemû¥t. Ich erfuhr, dass "nur ca. 5,5 Millionen Juden starben und nicht 6" und der "Bund deutscher MûÊdels mich damals gar nicht aufgenommen hûÊtte". Ein Klassenlehrer vermittelte alte Wehrmachtsromantik, indem er uns zur Strafe mit gekauten Kaugummis auf den Nasen strammstehen lieû. Die Kindheit verbrachte ich teilweise mit den Groûeltern und anderen Holocaustû¥berlebenden, die alle ihre Geschichten hatten. Dieses Haus erlebte ich immer voll mit Menschen und viel WûÊrme. Ich habe sozusagen die Auschwitzgeschichten mit der Muttermilch erhalten. Kein Wunder, dass ich zehn Jahre in der Jerusalemer Holocaust Gedenk-und ForschungsstûÊtte Yad Vashem arbeitete. "Berufsjû¥din" nennen das manche zynisch.
|  |
ôˋ Sabrina Goldemann. Purim, jû¥discher Kindergarten, Berlin 1967 |
Fathiyeh: Wie hat deine Familie den Krieg û¥berlebt?
Meine Groûeltern mû¥tterlicherseits sind im November 1938 mit einem der letzten Schiffe von Berlin nach Shanghai, China, gefahren. Ich habe ihnen nie verziehen, dass sie ins Nachkriegs-Berlin der frû¥hen 50er Jahre zogen, anstatt mit dem Rest der Familie nach New York in die Neue Welt zu schippern. Die amerikanischen Jû¥dInnen kennen nûÊmlich keine IdentitûÊtskrisen.
Die Mama ist im Juli 1939 in der chinesischen Hafenstadt geboren. Dort lebten circa 25.000 jû¥dische Flû¥chtlinge aus Mittel-und Osteuropa ã je nach Geldbeutel in kleinen Wohnungen oder Heimen. SpûÊter mussten die meisten in einem von Japanern bewachten Ghettodistrikt leben. Dank dem unerschrockenen Gemû¥t meines Groûvaters erhielt die Tochter tatsûÊchlich vom Nazikonsulat die deutsche Staatsbû¥rgerschaft. Er sorgte auch dafû¥r, dass die insgesamt sieben Familienmitglieder elf Jahre im fernen Osten û¥berlebten. Da er glaubte, dass Amerika keinen weiteren englisch sprechenden Juden mit jiddischem Akzent brauchte, zog er mit Frau und Kind 1950 zum Berliner Teil der Familie. Hier kam die Mama in der neuen Schule erstmals direkt mit dem Judenhass der Entnazifizierten in Berû¥hrung. Das ist nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Sie ist nie wirklich in Berlin angekommen. Seit 30 Jahren hû¥te ich die alten Unterlagen und Fotos und bastle selbst an der Familiengeschichte, weil meine Mutter û¥ber diese Zeit nie sprechen wollte. Jetzt hat sie Alzheimer, und erfreulicherweise sprudeln plûÑtzlich ã krankheitsbedingt ã ausschlieûlich Kindheitserinnerungen heraus.
|  |
ôˋ Sabrina Goldemann. Shanghai 1948. Die Groûeltern mit der damals 9jûÊhrigen Mutter von Sabrina Goldemann kurz vor der Abreise nach Berlin. |
Theoretisch kûÑnnte alles so einfach seinFathiyeh: Wie erlebst du Berlin jetzt?
Sabrina: Ich habe das Gefû¥hl, ich bin im Exil. Es ist spannend und abstoûend zugleich. Ich war wahrscheinlich zu naiv, als ich hoffte, mit meiner Bildung und Erfahrung schnell wieder Fuû zu fassen. Mir war nicht bewusst, dass fû¥r mich in Berlin die beruflichen Tû¥ren derart verschlossen sind. Die nichtjû¥dischen Antisemitismus- und GedenkstûÊttenexperten wollen unter sich sein. Die Berliner Kaffeehaus-und Kinokultur habe ich allerdings vermisst. Die Jû¥dInnen hier empfinde ich als zu still, und der Judenhass ist fû¥r meinen Geschmack etwas zu laut. Ich bin ja fast zeitgleich mit dem Al Quds-Tag 2013 eingetroffen. Was fû¥r ein Empfang.
Fû¥r die Kinder meiner frû¥heren Berliner FreundInnen "mit Migrationshintergrund" bin ich plûÑtzlich ein Feind. Ich habe meine Kinder immer tolerant erzogen, wollte, dass sie zuerst den individuellen Menschen sehen und nicht alle û¥ber einen Kamm scheren. Meine Tochter lief letztens auf einem Schulausflug Schlittschuh gemeinsam mit einem arabischen MûÊdchen aus Nablus. Sie haben sich gegenseitig helfend gestû¥tzt, erzûÊhlte sie mir lachend. Tja, theoretisch kûÑnnte alles so einfach sein.
Fathiyeh: Fû¥hlst du dich als Deutsche oder als Israelin?
Sabrina: Ich habe beide StaatsangehûÑrigkeiten, und das ist gut so. In Israel fû¥hle ich mich aber wirklich zu Hause. Berlin ist mir fremd geworden. Fragen, die mich lange gequûÊlt haben wie
"Was bin ich?", "Wohin gehûÑre ich?", "Wieso bin ich ausgerechnet hier?" kommen wieder hoch. Das existierte fû¥r mich zwûÑlf Jahre lang nicht und machte mein Leben einfacher. Die deutsche Diaspora ist eben nicht mein Lebenskonzept. Ich weiû û¥brigens, dass mir zwei Drittel der hier lebenden Israelis nicht zustimmen. Nach meiner Aliyah erfuhr ich zufûÊllig, dass ich meine deutsche StaatsangehûÑrigkeit verlor, weil ich nun Israelin bin. Mein Kampf um die Genehmigung zur Doppelstaatlichkeit rû¥ckte gleichzeitig mein gestûÑrtes IdentitûÊtsgefû¥ge zurecht, denn ich bin als Israelin mit deutschem Pass nach Berlin zurû¥ckgekommen. Damit kann ich gut leben. So kann ich auch in jeder Hinsicht als
"missing link" fungieren.
 Die so genannte Israel-Kritik und die reale Bedrohung durch die NachbarlûÊnderFathiyeh:
Die so genannte Israel-Kritik und die reale Bedrohung durch die NachbarlûÊnderFathiyeh: Wie gehst du mit der allgegenwûÊrtigen so genannten
"Israel-Kritik" um?
Sabrina: Es macht mich wû¥tend. Seit û¥ber 2500 Jahren gelten Juden als
"Brunnenvergifter", "RitualmûÑrder", "Parasiten", "Ausbeuter", "VerschwûÑrer", heimliche
"Weltherrscher" und nicht zu vergessen, als
"KindermûÑrder" ã bis jetzt. Heute nennt man das gerne Anti-Zionismus. Das soll uns mal jemand nachmachen. An allem sind wir schuld. Laut den VerschwûÑrungstheoretikerInnen sogar an den AnschlûÊgen in Paris. Warum spricht man in der ûffentlichkeit so wenig û¥ber den Anschlag auf den Pariser jû¥dischen Supermarkt? Ist es etwa zu deutlich, dass dieses Attentat nichts mit Israel zu tun hat, sondern mit blankem Hass? Das verstûÑrt offensichtlich viele Menschen, die auf der anderen Seite sehr eindringlich unserer Holocaustopfer gedenken.
Fathiyeh: Wie lebt es sich in Israel mit der stûÊndigen Kriegsgefahr durch die NachbarlûÊnder?
Sabrina: Das posttraumatische Stresssymptom ist innerhalb der israelischen Gesellschaft Dauergast. Also, meine letzten Jahre in Israel waren neben dem permanenten Raketenbeschuss aus Gaza vor allem geprûÊgt von der Gefahr eines Krieges mit dem Iran. Die meisten Israelis hatten noch nie Kontakt zu IranerInnen. Die israelischen Medien verbreiteten stûÊndig die Hasstiraden û¥ber Israel, die Holocaustleugnungen und die Drohungen der iranischen Regierung, unser Land zu vernichten, was wiederum von vielen deutschen PolitikerInnen und JournalistInnen gerne als
"ûbersetzungsfehler" bezeichnet wird. Und plûÑtzlich, 2012, gab es diese
"Israel loves Iran"-Kampagne, ausgelûÑst von dem israelischen Graphikdesigner Ronny Edry. Viele VertreterInnen beider Seiten haben gemerkt, dass sie Angst voreinander hatten, weil sie nichts û¥bereinander wussten. Diese naiv anmutende Aktion entstand aus einer tiefen realen Angst heraus und hat natû¥rlich auf der Gegenseite nur bei sûÊkularen, kreativen und modernen IranerInnen Anklang gefunden. In gewisser Weise wurde dadurch in Teilen beider BevûÑlkerungen ein Feindbild zerstûÑrt. Wenn das mit IranerInnen funktioniert, dann auch mit anderen. Dafû¥r mûÑchte ich mich hier auch einsetzen.
Fathiyeh: Was denkst du û¥ber den Apartheid-Vorwurf?
Sabrina: Wie in jedem Volk gibt es auch jû¥dische RassistInnen, MûÑrderInnen und GanovInnen. Wir mû¥ssen aber immer einen doppelten Heiligenschein tragen, um als normale Menschen gesehen zu werden. Das muss aufhûÑren. Natû¥rlich gibt es Ungerechtigkeiten in Israel gegenû¥ber AraberInnen und nicht nur umgekehrt, die durch gegenseitiges Misstrauen geschû¥rt werden. Das darf man auch nicht leugnen. Aber in einem Apartheidregime gûÊbe es keine arabische Siegerin bei der Wahl zur "Miss Israel" oder zur "Voice of Israel". Kannst du dir dagegen eine jû¥dische Miss Jordan oder Libanon vorstellen?
Einige Zeit bin ich regelmûÊûig mit einer Araberin aus Ostjerusalem zur Arbeit gelaufen. Sie gehûÑrte zum Servicepersonal. Eines Tages lief sie vor mir, lûÑste lachend ihren Hijab beim Laufen, schû¥ttelte ihr frisch gefûÊrbtes Haar und begann, sich zu schminken. Ein bewegendes Bild. Auf dem Weg von der Arbeit zur Straûenbahn hat sie sich wieder zurû¥ck verwandelt, wie sie es nannte. Fatina erzûÊhlte mir jeden Morgen ein bisschen mehr aus ihrem Leben. Wir waren gleichaltrig, geschieden und hatten beide zwei Kinder. Meine alltûÊgliche Freiheit kann sie aber nur wûÊhrend ihrer achtstû¥ndigen Arbeitszeit fû¥hlen. Einmal erzûÊhlte ich ihr, dass in Deutschland viele Menschen Israel und Apartheid gleichstellen. Sie hielt ihr Kopftuch hoch und sagte:
"Es sind nicht die Juden, die mich dazu zwingen".
 Sabrina Goldemann
Sabrina Goldemann, 52, ist Kommunikationswissenschaftlerin. Berlin-Israel-Berlin war ihre bisherige Lebensroute, Fortsetzung kann folgen. Sie ist vor allem engagiert, die vielen Facetten des weltweiten Antisemitismus zu demaskieren und sich in den deutsch-jû¥dischen/israelischen und jû¥disch-muslimischen Dialog einzubringen. Durch Texte, Beratung und Forschung mûÑchte sie u.a., auch in der etablierten deutschen Welt der Antisemitismus- und Shoahforscher, "jû¥dische" Akzente setzen. Auch eigene Projekte sind in Planung, zu denen sie ihre langjûÊhrige Arbeit in der GedenkstûÊtte Yad Vashem inspirierte.
Sabrina Goldemann macht derzeit eine Weiterbildung zur psychologischen Beraterin. Ihr berufliches Motto ist Aristoteles entlehnt: "Denk wie ein Weiser und sprich wie das gemeine Volk".
Das Interview, das Sabrina Goldemann mit Fathiyeh Naghibzadeh gefû¥hrt hat, finden Sie auf
AVIVA-Berlin>Lokale Geschichte_n Dieser Beitrag wurde von den Autorinnen am Dienstag, 14. April 2014 im Rathaus Charlottenburg prûÊsentiert.
Dieser Beitrag wurde von den Autorinnen am Dienstag, 14. April 2014 im Rathaus Charlottenburg prûÊsentiert.Auûerdem sprachen unsere
Schirmfrauen des Projektes, die Senatorin fû¥r Arbeit, Integration und Frauen
Dilek Kolat, sowie die Gleichstellungsbeauftragte
Carolina BûÑhm, sowie die Initiatorinnen Sharon Adler und Claire Horst
 "Lokale Geschichte(n) Charlottenburg-Wilmersdorf" wird gefûÑrdert durch:
"Lokale Geschichte(n) Charlottenburg-Wilmersdorf" wird gefûÑrdert durch: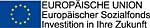



Copyright Fotos von Sabrina Goldemann und Fathiyeh Naghibzadeh: Sharon Adler
Copyright Fotos von Sabrina Goldemann an Purim und dem Foto ihrer Groûeltern und Mutter in Shanghai: Sabrina Goldemann
